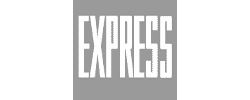Ein aktueller Beschluss zeigt, wie schwierig es für Betroffene ist, gegen Identitätsdiebstahl in sozialen Netzwerken vorzugehen. Wer Opfer eines Fake-Profils wird, kann bislang nur eingeschränkt gegen unbekannte Täter vorgehen. Ob der Gesetzgeber hier nachbessert, bleibt offen.

Das Landgericht (LG) Koblenz hat entschieden, dass der Betreiber der Plattform Instagram keine Bestandsdaten herausgeben muss, wenn es sich nicht um rechtswidrige audiovisuelle Inhalte handelt. Reine Fotos oder Textnachrichten genügen nicht, um einen Auskunftsanspruch zu begründen (Beschl. v. 25.08.2025, Az. 2 O 1/25). Der Fall macht deutlich, dass das geltende Recht eine Lücke aufweist.
Gefälschtes Profil mit echtem Foto löst rechtlichen Streit aus
Ausgangspunkt war ein gefälschtes Instagram-Profil. Eine Frau stieß zufällig auf einen Account, der ihr eigenes Profil täuschend echt nachbildete. Profilbild, Name und Inhalte entsprachen nahezu vollständig ihrem echten Auftritt. Der unbekannte Betreiber hatte ein Foto aus dem Jahr 2019 übernommen und auch private Details wie ein geplantes Auslandsjahr kopiert. Damit wirkte das Profil authentisch und führte dazu, dass Nachrichten des Fake-Accounts an Dritte zunächst für echt gehalten wurden.
Der Betreiber des Profils versandte Textnachrichten, in denen er sich als die Frau ausgab. Er verwendete sogar ihre vollständige Wohnadresse. Mehrere Personen, die über die Plattform angeschrieben wurden, waren verunsichert. Die Betroffene wollte die Identität des Kontoinhabers klären und wandte sich an den Technologiekonzern Meta Platforms, unter dem das Soziale Netzwerk Instagram läuft.

Soforthilfe vom Anwalt
Sie brauchen rechtliche Beratung? Rufen Sie uns an für eine kostenlose Ersteinschätzung oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Sie verlangte die Herausgabe der hinterlegten Bestandsdaten. Dazu gehören Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Nutzers. Zur Begründung verwies sie auf § 21 Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz (TDDDG). Nach ihrer Auffassung sei die Plattform sowohl berechtigt als auch verpflichtet, die gewünschten Daten offenzulegen.
Instagram lehnte dies ab. Das Unternehmen erklärte, die Voraussetzungen des Gesetzes lägen nicht vor. Es greife nur bei rechtswidrigen audiovisuellen Inhalten oder bei bestimmten Straftatbeständen. Weder das Erstellen eines Profils noch das Versenden von Textnachrichten seien davon erfasst. Daraufhin stellte die Frau einen Antrag beim LG Koblenz.
Gericht sieht Fotos nicht als audiovisuelle Inhalte
Das LG Koblenz verwies zunächst § 21 Abs. 3 TDDDG, der regelt, wie über die Zulässigkeit und Verpflichtung zur Auskunftserteilung entschieden wird. Inhaltlich verweist die Vorschrift auf Absatz 2. Danach darf ein Anbieter digitaler Dienste Auskunft über Bestandsdaten geben, wenn dies zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche wegen rechtswidriger audiovisueller Inhalte oder wegen bestimmter Straftaten erforderlich ist.
Da die Betroffene selbst nicht der Auffassung war, dass Straftatbestände erfüllt seien, komme es auf die Frage an, ob es sich um „rechtswidrige audiovisuelle Inhalte“ handele. Die Richterinnen und Richter prüften daher, ob die im Verfahren relevanten Inhalte überhaupt als „audiovisuelle Inhalte“ gelten. Zwar ist dieser Begriff nicht legaldefiniert – jedoch kamen sie anhand einer Auslegung des Wortlauts nach dem allgemeinen Sprachgebrauch zu dem Ergebnis, dass audiovisuelle Inhalte sowohl hörbar als auch sichtbar sein müssten. Reine Fotos oder Textnachrichten erfüllten dieses Kriterium hingegen nicht.
Die Antragstellerin verwies zusätzlich auf § 1 Abs. 4 Nr. 7 Digitale-Dienste-Gesetz (DDG). Diese Vorschrift definiere einen ähnlichen Begriff, nämlich „audiovisuelle Kommunikation“ als „jede Form der Kommunikation mit Bildern mit oder ohne Ton“, die wirtschaftlichen Zwecken diene. Danach könnten auch Fotos als audiovisuelle Inhalte einzustufen sein. Das Gericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht. Es betonte, dass die Definition im DDG ausdrücklich audiovisuelle Kommunikation betreffe und sich auf kommerzielle Inhalte beziehe. Eine entsprechende Anwendung auf § 21 TDDDG komme nicht in Betracht.
Lücken im Schutz vor Identitätsdiebstählen
Nach Auffassung des Gerichts würde eine erweiternde Auslegung die Auskunftsrechte erheblich ausweiten. Damit wären tiefgreifende Eingriffe in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verbunden. Eine solche Änderung dürfe nur der Gesetzgeber vornehmen. Die Kammer sah sich an den Wortlaut der Norm gebunden und wies den Antrag der Klägerin auf Täterauskunft ab.
Gleichzeitig zeigte das Gericht Verständnis für die Situation der Betroffenen. Der vorliegende Fall verdeutliche, dass die bestehende Regelung Lücken aufweise. Das Gericht war der Auffassung, dass auch bei Bildern und Texten ein erhebliches Informationsinteresse bestehen könne und eine entsprechende Erweiterung sinnvoll sei. Dennoch sei es nicht Aufgabe der Gerichte, den Anwendungsbereich über den Wortlaut hinaus zu erweitern. Hier müsse der Gesetzgeber nachbessern.
WBS-LEGAL – Ihr Partner im Medienrecht
Wer im Internet von Rechtsverletzungen betroffen ist, sollte rechtzeitig professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. WBS.LEGAL als eine der führenden Kanzleien im Medienrecht vertritt Mandanten in allen Fragen rund um Rundfunk, Presse und digitale Kommunikation. Wenn Sie Opfer eines Fake-Profils geworden sind, rechtliche Unterstützung benötigen oder Fragen zu Ihren Rechten im Medienbereich haben, können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden. Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne unter 0221 / 951 563 0 (Beratung bundesweit). Gemeinsam finden wir eine Lösung für Ihr Anliegen.
ptr