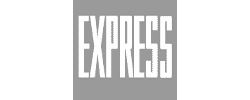Vor gut drei Jahren sah sich der RBB Vorwürfen von Vetternwirtschaft, überhöhten Zahlungen und fehlender Kontrolle ausgesetzt. Ein neuer Rundfunkstaatsvertrag sollte den RBB transparenter machen. Dies jedoch verletze gleich mehrfach die Rundfunkfreiheit, weshalb der RBB vor das BVerfG zog – und nun unterlag.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat entschieden, dass der neue Staatsvertrag für den Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Der Sender hatte geltend gemacht, dass verschiedene Regelungen seine Rundfunkfreiheit einschränkten. Das BVerfG sah dies jedoch nun anders und bestätigte die Gestaltungsfreiheit der Länder Berlin und Brandenburg bei der Ausgestaltung des öffentlich rechtlichen Rundfunks. Damit bleibt der neue Staatsvertrag in allen wesentlichen Teilen bestehen (BVerfG, Beschluss vom 23.07.2025, Az. 1 BvR 2578/24).
Reform beim RBB
Im Jahr 2022 erschütterten Vorwürfe von Vetternwirtschaft, überhöhten Zahlungen und fehlender Kontrolle den RBB. Die öffentliche Kritik war massiv und führte zu einem großen Vertrauensverlust. Berlin und Brandenburg als gemeinsame Trägerländer beschlossen daher, den RBB auf eine neue Grundlage zu stellen. Im November 2023 unterzeichneten beide Länder einen neuen Staatsvertrag, der nach Zustimmung durch die Landesparlamente am 1. Januar 2024 in Kraft trat. Mit diesem Vertrag sollte die Transparenz im Sender erhöht, die Kontrolle verbessert und die regionale Ausrichtung gestärkt werden. Für den RBB bedeutete das eine tiefgreifende Neuordnung der eigenen Strukturen. Gegen mehrere der Regelungen legte der Sender in der Folge Verfassungsbeschwerde ein, weil er darin eine Verletzung der Rundfunkfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 2 des Grundgesetzes sah.
Konkret richtete sich die Beschwerde gegen fünf Punkte. Erstens wurde durch den Vertrag neben der bisherigen Intendanz ein Direktorium geschaffen. Dieses besteht aus dem Intendanten sowie zwei weiteren Direktoren. Gemeinsam sollen sie über besonders wichtige Fragen entscheiden und Konflikte zwischen den Geschäftsbereichen klären. Zweitens legte der Vertrag fest, dass der RBB bestimmte regionale Standorte erhalten muss. Dazu gehören Studios in Cottbus und Frankfurt an der Oder sowie Büros in Brandenburg an der Havel, Prenzlau und Perleberg. Drittens enthält der Vertrag Vorgaben zur Programmgestaltung. Danach muss das Fernsehprogramm für Berlin und Brandenburg täglich mindestens 60 Minuten getrennt werden, damit jedes Land einen eigenen Programmblock erhält. Viertens wurde eine zusätzliche Leitungsebene für die Landesprogramme eingeführt, die direkt der Programmleitung untersteht. Fünftens verpflichtete der Vertrag den rbb dazu, alle Stellen öffentlich auszuschreiben und enthielt zudem neue Haftungsregelungen für Mitglieder der Aufsichtsgremien und die Intendanz.
Der RBB argumentierte, dass diese Vorgaben seine Programmautonomie beschneiden würden, die Handlungsfähigkeit der Intendanz schwächten und die Attraktivität von Führungspositionen mindern würden. Er machte außerdem geltend, dass die Pflicht zur Stellenausschreibung ohne Ausnahmen sowie die verschärfte Haftung qualifizierte Bewerber abschrecken könnten.
RBB-Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen
Das BVerfG stellte zunächst klar, dass dem Gesetzgeber bei der Organisation des öffentlich rechtlichen Rundfunks ein weiter Gestaltungsspielraum zukomme. Vorgeschrieben sei hier kein bestimmtes Modell für die Geschäftsleitung. Sowohl eine alleinige Verantwortung der Intendanz als auch eine kollegiale Leitung seien denkbar. Entscheidend sei allein, dass die Funktionsfähigkeit des Senders nicht gefährdet werde und die Verantwortlichkeiten klar zugeordnet blieben.
Vor diesem Hintergrund hielt das BVerfG die Einführung des Direktoriums für unbedenklich. Zwar führe die kollegiale Entscheidungsstruktur dazu, dass die Intendanz Kompetenzen abgeben müsse. Dies sei jedoch kein Verstoß gegen die Rundfunkfreiheit. Vielmehr ermögliche das Direktorium eine ausgewogene Entscheidungsfindung und gegenseitige Kontrolle. Sollte die Intendanz mit Beschlüssen des Direktoriums nicht einverstanden sein, könne sie widersprechen und so ihre Gesamtverantwortung wahrnehmen. Die Befürchtung des RBB, dass es zu Blockaden komme, sei zwar denkbar, gefährde die Funktionsfähigkeit des Senders jedoch nicht.
Auch die Vorgaben zur Regionalität bewertete das Gericht positiv. Die Pflicht, Studios und Büros in bestimmten Städten zu unterhalten, sichere die Präsenz des RBB in der Fläche. Dadurch werde die regionale Vielfalt im Programm gefördert. Der RBB sei eine Mehrländerrundfunkanstalt, die beiden Ländern gleichermaßen verpflichtet ist. Die Sicherung von Regionalität sei daher ein legitimes Anliegen. Auch europarechtlich sei die Förderung des Medienpluralismus anerkannt.
Die tägliche Auseinanderschaltung der Fernsehprogramme für Berlin und Brandenburg um mindestens 60 Minuten verletze die Programmautonomie ebenfalls nicht. Zwar gehöre es zum Kern der Rundfunkfreiheit, über Umfang und Zeit der Programme frei zu entscheiden. Der Eingriff sei jedoch gering, weil die zeitliche Vorgabe im Verhältnis zum Gesamtprogramm eng bemessen sei und der Sender darüber hinaus weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten behalte. Das BVerfG stellte klar, dass es sich hierbei nicht um eine inhaltliche Einflussnahme handele, sondern um eine Mindestvorgabe für die Wahrnehmbarkeit regionaler Themen.
Auch die zusätzliche Leitungsebene für die Landesprogramme bewertete das Gericht als zulässig. Es sei nicht erkennbar, dass dadurch die Funktionsfähigkeit des Senders beeinträchtigt werde. Eine unzulässige staatliche Einflussnahme auf die Programmarbeit der Mitarbeitenden sei ebenfalls nicht erkennbar.
Unzulässig war die Beschwerde nur in Bezug auf die Pflicht zur Stellenausschreibung und die Haftungsregelungen. Hier habe der RBB nicht ausreichend dargelegt, dass tatsächlich eine Beeinträchtigung der Rundfunkfreiheit vorliege. Insbesondere die Behauptung, es könnten sich weniger qualifizierte Bewerber melden, sei nicht genügend dargelegt worden.
Damit kam das BVerfG zu dem Ergebnis, dass der neue RBB Staatsvertrag verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Die Länder Berlin und Brandenburg hätten ihre Verantwortung für den öffentlich rechtlichen Rundfunk ordnungsgemäß wahrgenommen. Die angegriffenen Regelungen seien geeignet, Transparenz zu erhöhen, die regionale Vielfalt zu sichern und das Vertrauen in den RBB zu stärken.
WBS-LEGAL – Ihr Partner im Medienrecht
Die Entscheidung zeigt, wie groß der Gestaltungsspielraum der Länder bei der Organisation des öffentlich rechtlichen Rundfunks ist. Für die Sender bedeutet dies eine klare rechtliche Grundlage, an die sie sich halten müssen. Für Betroffene und Verantwortliche kann dies jedoch komplexe Fragen aufwerfen. Genau hier unterstützen wir Sie. WBS.LEGAL als eine der führenden Kanzleien im Medienrecht vertritt Mandanten in allen Fragen rund um Rundfunk, Presse und digitale Kommunikation. Wenn Sie rechtliche Unterstützung benötigen oder Fragen zu Ihren Rechten im Medienbereich haben, können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden. Gemeinsam finden wir eine Lösung für Ihr Anliegen.
tsp