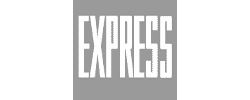Ferrari wollte die Marke „Testa Rossa“ löschen lassen – und scheiterte, trotz Ähnlichkeit zu ihrer eigenen „Testarossa“. Der BGH erläutert, warum es für eine bösgläubige Markenanmeldung Schädigungs- oder Behinderungsabsicht braucht und wann diese vorliegt.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass die Markenanmeldung „Testa Rossa“ durch einen deutschen Modellautohersteller nicht als bösgläubig anzusehen ist. Zwar hatte Ferrari geltend gemacht, der Anmelder wolle von der Bekanntheit ihrer eigenen Marke „Testarossa“ profitieren. Doch nach Ansicht des Gerichts liege deswegen noch keine Schädigungs- oder Behinderungsabsicht vor. Dies sei aber Voraussetzung für die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung. Die bloße Ähnlichkeit der Marken reiche nicht aus. Der BGH betont: Wer – wie hier Ferrari – eine Markenanmeldung wegen Bösgläubigkeit angreifen wolle, trage die volle Beweislast für die unlautere Absicht des Anmelders. Im Ergebnis bleibt die Marke „Testa Rossa“ für den Modellautohersteller daher eingetragen (Beschl. v. 11.09.2025, Az. I ZB 6/25).
Ferrari gegen deutsches Unternehmen – der Streit um „Testa Rossa“
Seit Jahrzehnten ist der Name „Testarossa“ untrennbar mit Ferrari verbunden. Bereits in den 1950er Jahren setzte der italienische Sportwagenhersteller den Namen für seine Rennwagen ein. Zwischen 1984 und 1996 wurden rund 7000 Exemplare des Zwölfzylinder-Coupés gebaut. Die Marke „Testarossa“ wurde 2007 auch als Unionsmarke für Fahrzeuge und Modellspielzeuge geschützt.
Im Jahr 2013 meldete ein deutscher Unternehmer, der seit rund 50 Jahren in der Spielzeug- und Modellautobranche tätig ist, beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Marke „Testa Rossa“ für eine Vielzahl von Waren an. Die Anmeldung umfasste neben Spielzeugen und Modellautos auch etwa Sportartikel, Fahrräder, Küchengeräte, Haushaltswaren und Werkzeuge. Die Marke wurde im Jahr 2015 eingetragen.
Bereits in der Vergangenheit hatte es zahlreiche Auseinandersetzungen zwischen Automobilherstellern wie Ferrari und dem Anmelder gegeben. Immer wieder ging es dabei um die Darstellung von Fahrzeugmarken auf Modellspielzeugen und um Lizenzfragen. Der Anmelder selbst hatte in der Vergangenheit gegen verschiedene Ferrari-Marken Löschungs- und Verfallsanträge gestellt, teils gemeinsam mit Verbänden aus der Modellspielzeugbranche. Erst im Sommer dieses Jahres erklärte das Europäische Gericht (EuG), dass die Marke weiterhin genutzt würde – u.a. durch Verkäufe gebrauchter Sportwagen, den Handel mit Originalteilen und die Lizenzierung von Modellautos.
Im aktuellen Fall legte Ferrari zunächst Widerspruch gegen die Eintragung der Marke durch den Modellauto-Hersteller ein, gestützt auf ihre eigene Marke „Testarossa“. Später beantragte Ferrari auch die Löschung der Marke „Testa Rossa“ mit der Begründung, sie sei bösgläubig angemeldet worden. Der italienische Automobilhersteller warf dem Anmelder vor, er wolle vom Ruf der berühmten Marke profitieren und gezielt deren wirtschaftliche Entfaltung behindern. Das DPMA entschied zunächst im Jahr 2021, den Antrag auf Löschung zurückzuweisen. Ferrari legte daraufhin Beschwerde beim Bundespatentgericht (BPatG) ein. Doch auch dieses sah keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine bösgläubige Anmeldung und wies die Beschwerde zurück (Beschl. v. 15.01.2025, Az. 29 W (pat) 14/21). Ferrari legte schließlich Rechtsbeschwerde zum BGH ein.
BGH: Keine Bösgläubigkeit ohne Schädigungsabsicht
Der BGH befasste sich nun mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Markenanmeldung als bösgläubig anzusehen ist. Die rechtliche Grundlage bilden § 50 Abs. 1 MarkenG aF in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aF. § 8 MarkenG schreibt hier vor, dass Marken, die bösgläubig angemeldet wurden, nicht schutzfähig sind (Absolutes Schutzhindernis; Nichtigkeitsgrund).

Soforthilfe vom Anwalt
Sie brauchen rechtliche Beratung? Rufen Sie uns an für eine kostenlose Ersteinschätzung oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Grundvoraussetzung sei, dass der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür Markenrechtsschutz erworben zu haben. Das war hier zwar der Fall. Allerdings stellte der BGH klar: Eine bloße Ähnlichkeit zu einer älteren Marke reiche für die Annahme der Bösgläubigkeit nicht aus.
Entscheidend sei vielmehr, ob der Anmelder die Marke mit dem Ziel angemeldet habe, die Interessen eines Dritten gezielt zu schädigen oder zu behindern. Hierfür müssten besondere Umstände im Einzelfall hinzukommen. Bislang sind hier vor allem drei (nicht abschließende) Fallgruppen anerkannt. Bösgläubig ist die Markenanmeldung dann, wenn ihr Ziel es ist:
- eine Vielzahl von Marken zu Spekulationszwecken zu „horten“ ohne echten Benutzungswillen, um Dritte mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (Hauptanwendungsfall).
- den schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers zu stören oder die Marke für seine Waren zu sperren.
- Einen zweckfremden Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfs zu beabsichtigen.
Der BGH betonte, dass derjenige, der sich auf Bösgläubigkeit beruft, die volle Beweislast dafür trage. Das bedeutet: Es müssen objektive, stimmige Anhaltspunkte vorgelegt werden, die eine unlautere Absicht des Markenanmelders erkennen lassen. Nur dann sei der Markeninhaber verpflichtet, seine Absichten näher zu erläutern.
Keine Indizien für Schädigungsabsicht im konkreten Fall
Im konkreten Fall habe Ferrari keine hinreichenden Indizien vorlegen können, die auf eine solche Behinderungs- oder Drittschädigungsabsicht im Zeitpunkt der Anmeldung hindeuteten. Zwar hatte der Anmelder eine Vielzahl von Marken angemeldet, darunter auch mehrere Varianten von „Testa Rossa“ für unterschiedlichste Warenklassen. Doch das allein rechtfertige nicht den Vorwurf der Markenhortung oder Spekulation.
Der BGH bestätigt hier die Ansicht des BPatG: Dem Markeninhaber könne ein eigener genereller Benutzungswille nicht ohne Weiteres abgesprochen werden. Ein Lizenzgeschäft, wie es der Anmelder verfolge, sei ein legitimes Geschäftsmodell. Die Marke „Testa Rossa“ könne durchaus sinnvoll im Bereich von Spielzeug oder anderen Produkten verwendet werden. Außerdem fehle es an konkreten Anhaltspunkten, dass die Anmeldung mit der eindeutigen Absicht erfolgt sei, Dritte in rechtsmissbräuchlicher Weise bei der Verwendung gleicher oder ähnlicher Marken zu behindern.
Die mögliche Tatsache, dass der Anmelder mit der Marke „Testa Rossa“ vom Ruf Ferraris profitieren wolle, sei für sich genommen nicht ausreichend. Ein solches Verhalten könne zwar problematisch sein, doch im Markenrecht gelte: Wer eine Marke anmeldet, dürfe grundsätzlich auch wirtschaftliche Ziele verfolgen. Das bloße Trittbrettfahren sei keine Bösgläubigkeit, solange nicht weitere Umstände hinzuträten, etwa eine gezielte Schädigungsabsicht.
Marke anmelden? Wunschmarke in 2 Minuten prüfen!
Wir bieten eine kostenfreie Ersteinschätzung an, um zu prüfen, ob Ihr gewünschter Markenname oder Logo eintragungsfähig sein könnte. Einfach Formular ausfüllen & Rückmeldung erhalten!
Dass der Anmelder zum Zeitpunkt seiner Markenanmeldung nicht genau wusste, wie er die angemeldete Marke benutzen würde, sei ebenfalls unschädlich. Markenanmelder verfügten über einen Zeitraum von fünf Jahren, um eine tatsächliche Benutzung aufzunehmen.
Auch der Umstand, dass der Anmelder bereits zuvor rechtliche Schritte gegen Ferrari eingeleitet hatte, begründe keine Behinderungsabsicht. Vielmehr könne dies auch auf Meinungsverschiedenheiten über Lizenzrechte zurückzuführen sein.
Bekanntheit der Marke ist kein absolute Schutzhindernis
Ein weiteres Argument Ferraris war die Bekanntheit der eigenen Marke „Testarossa“. Doch auch hier stellte der BGH klar, dass die Bekanntheit einer Marke kein absolutes Schutzhindernis darstelle. Und das Vorliegen eines relativen Schutzhindernisses reiche allein nicht zur Annahme der Bösgläubigkeit der Markenanmeldung ausreicht. Ein relatives Schutzhindernis könne zwar bei der Bewertung der Bösgläubigkeit eine Rolle spielen, ersetze aber nicht die erforderlichen konkreten Anhaltspunkte für eine unlautere Absicht. Dies gelte vor allem für die relativen Schutzhindernisse, die kein subjektives Moment voraussetzen, wie der Fall der Doppelidentität oder der Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG). Diese seien im Widerspruchsverfahren oder in zivilrechtlichen Klagen geltend zu machen.
Im vorliegenden Fall hatte Ferrari zwar das relative Schutzhindernis des „Schutzes bekannter Marken“ nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vorgetragen. Danach könnte die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn die neue Marke mit einer älteren, identisch oder ähnlich ist und die neue Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund „in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde“. Ein Element dieses Schutzhindernisses sei hier die zu missbilligende Absicht des Anmelders. Deshalb könne dieses relative Schutzhindernis im Rahmen der Gesamtabwägung aller Umstände des Streitfalls dafür sprechen, dass die Markenanmeldung bösgläubig erfolgt sei. Dies aber nur, wenn weitere Umstände hinzuträten, die dies nahelegten. Das habe das BPatG jedoch nicht festgestellt.
Diese Rechtsprechung stehe auch im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des EuGH, daher sei der Fall nicht vorzulegen gewesen. Insbesondere habe der EuGH geklärt, dass die Annahme der Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung ein subjektives Element – eine Behinderungsabsicht – des Markeninhabers im Zeitpunkt der Anmeldung voraussetze. Geklärt sei auch, dass derjenige, der geltend macht, eine Marke sei bösgläubig angemeldet worden, hierfür die Feststellungs- beziehungsweise die Beweislast trage. Deswegen sei der Fall nicht vorzulegen gewesen. Schließlich habe auch der EuGH schon bestätigt, dass relative Schutzhindernisse bei der Prüfung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, berücksichtigt werden könnten.
Im Ergebnis blieb der Angriff Ferraris ohne Erfolg – die Marke „Testa Rossa“ bleibt eingetragen.
WBS.LEGAL – Ihre Ansprechpartner im Markenrecht
Gerade im Bereich des Markenrechts kommt es häufig zu komplexen und langjährigen Streitigkeiten. Ob es um die Eintragung einer neuen Marke geht, um die Verteidigung gegen Widersprüche oder um die Löschung fremder Marken wegen Bösgläubigkeit – in all diesen Fällen stehen wir Ihnen als erfahrene Kanzlei zur Seite.
Unsere spezialisierten Rechtsanwälte bei WBS.LEGAL verfügen über umfassende Expertise im Markenrecht und vertreten sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen bundesweit. Wir unterstützen Sie bei der strategischen Markenentwicklung, führen Widerspruchs- und Löschungsverfahren für Sie durch und verteidigen Ihre Marke mit Nachdruck. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Marke oder einem laufenden Verfahren haben, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie individuell, kompetent und zielgerichtet.
ahe