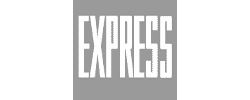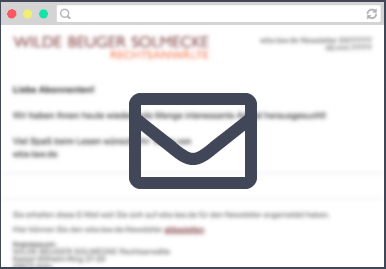Menschen werden im Netz immer häufiger Opfer von digitaler Gewalt. Die Möglichkeiten, sich gegen Hass und Hetze zur Wehr zu setzen, sind dabei bisher in der Praxis nicht ausreichend. Oft scheitert die Suche nach Gerechtigkeit bereits an der Möglichkeit, die Identität der Täter ausfindig zu machen. Aber das könnte sich jetzt ändern: Das BMJ hat vorgestellt, wie ein neues Gesetz gegen digitale Gewalt aussehen könnte.

Das gegenwärtige Recht befähigt Betroffene nicht in ausreichendem Maße dazu, sich effektiv gegen Rechtsverletzungen im Internet, insbesondere durch Hassrede, zu wehren. Häufig scheitert die Durchsetzung der eigenen Rechte bereits daran, dass es nicht gelingt, zügig und mit vertretbarem Aufwand Auskunft über die Identität des Verfassers rechtswidriger Inhalte zu erlangen.
Seit Oktober 2017 gibt es zwar unter anderem das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Dieses auch Facebook-Gesetz genannte Regelungswerk richtet sich vor allem an die Betreiber von sozialen Netzwerken und soll Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten und andere strafbare Inhalte auf den Plattformen sozialer Netzwerke bekämpfen. Es wird jedoch mit dem Geltungsbeginn des Digital Services Act (DSA) der EU aufgehoben. Beim DSA handelt es sich um eine EU-Verordnung, welche direkt in den Staaten anwendbar ist. Der DSA ist bereits seit November 2022 in Kraft, jedoch erst ab 17. Februar 2024 in allen EU-Staaten anwendbar. Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) und die Ampelkoalition planen deshalb, neue Gesetze gegen digitale Gewalt vorzulegen. Zum einen das Digitale-Dienste-Gesetz (DDG), welches den DSA umsetzen und den Rechtsrahmen für digitale Dienste in Deutschland und deren Haftung modernisieren soll.
Neu – verglichen mit den Regelungen im NetzDG – ist, dass Anbieter nun nicht mehr verpflichtet sind, innerhalb von 24 Stunden offensichtlich rechtswidrige Inhalte wie Hassrede zu löschen. Vielmehr soll künftig nur noch ein Verhaltenskodex für Anbieter digitaler Inhalte bestehen, welcher diesen aufgibt „zeitnah, sorgfältig, frei von Willkür und objektiv über die gemeldeten Informationen“ zu entscheiden. Zudem ist die Bundesnetzagentur und nicht mehr das BMJ für die Plattformaufsicht zuständig. Bei Verstößen gegen den DSA sieht der Gesetzesentwurf des DDG Buß- und Zwangsgelder vor.

Soforthilfe vom Anwalt
Sie brauchen rechtliche Beratung? Rufen Sie uns an für eine kostenlose Ersteinschätzung oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Zum anderen ist ein Gesetz gegen digitale Gewalt geplant, welches ergänzend die privaten Rechte der Nutzer stärken und die rechtlichen Hürden für Betroffene abbauen soll. Hierzu liegt derzeit noch kein Gesetzesentwurf, sondern nur ein Eckpunktepapier aus dem April vor. Durch das Eckpunktepapier sollen den Betroffenen mehr Handhaben in der Bekämpfung digitaler Gewalt gegeben werden. Unter anderem sind richterlich angeordnete Accountsperren und umfassendere Auskunftsrechte vorgesehen. Die Regelungen sollen zeitgleich mit der Geltung des DSA in Kraft treten und diesen ergänzen. Der DSA treffe nur wenige Aussagen über die privaten Rechte von Nutzern und regle auch nicht deren Durchsetzung, so das BMJ. Daher könnten beide Gesetze für dieselbe Materie nebeneinander anwendbar sein. Folgendes ist in dem Eckpunktepapier geplant.
Privater Auskunftsanspruch soll verstärkt werden
Ein Kernstück des Eckpunktepapiers gegen digitale Gewalt ist die Stärkung des Auskunftsrechts für Betroffene. Denn Voraussetzung der privaten Rechtsdurchsetzung ist, dass Betroffene die Identität des Verletzers erfahren können. Vor allem bei Rechtsverletzungen im Netz ist dies bislang eine der größten Hürden. Bisher gibt es einen Auskunftsanspruch Privater nach dem Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG). Dieser Anspruch ist jedoch mit einem langwierigen Verfahren verbunden. Außerdem dürfen bisher nur Bestandsdaten herausgegeben werden – so beispielsweise der Name und die E-Mail-Adresse des Verletzers, welche wegen ihrer fehlenden Echtheit oft keinen realen Mehrwert haben.
Dieser bestehende Auskunftsanspruch soll bald durch einen weiteren Anwendungsbereich verbessert werden. Das bedeutet, dass in Zukunft auch Ansprüche auf die Herausgabe von Nutzungsdaten wie IP-Adressen bestehen könnten, soweit dies verhältnismäßig und für die Rechtsverfolgung erforderlich ist. Bisher können außerdem nur Anbieter von Telemedien, also beispielsweise soziale Medien, zur Auskunft verpflichtet werden. Das genügt jedoch meist nicht. Durch die geplante Änderung sollen darüber hinaus auch die Messenger- oder Internetzugangsdienste gerichtlich verpflichtet werden können, entsprechende Daten herauszugeben. Konkret soll das über ein zweistufiges gerichtliches Verfahren möglich sein: Auf der ersten Stufe erhält die betroffene Person vom sozialen Netzwerk die IP-Adresse, unter welcher der rechtswidrige Inhalt veröffentlicht worden ist. Auf der zweiten Stufe muss dann der Internetprovider, der die genannte IP-Adresse vergeben hatte, aufgrund gerichtlicher Entscheidung darüber Auskunft geben, welchem seiner Kunden die IP-Adresse zum Zeitpunkt der Äußerung zugeordnet war. So könnte man die IP-Adresse konkret zuordnen und auch tatsächlich die Identität des Verletzers herausfinden.
Darüber hinaus sollen alle Fälle der Verletzung absoluter Rechte inbegriffen sein. Das bedeutet, dass beispielsweise auch nicht strafbare Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb einen Anspruch auf Auskunft begründen können. Der bisherige Auskunftsanspruch ist nur in Fällen anwendbar, in denen bestimmte strafbare Inhalte geteilt wurden. Inbegriffen sind bisher beispielsweise Beleidigungen oder Verleumdungen im Sinne des Strafgesetzbuchs (StGB). Schließlich sollen auch einstweilige Anordnungen bei offensichtlichen Rechtsverletzungen dazu berechtigen, Diensteanbieter zur Auskunft zu verpflichten.
Effektivere Ausgestaltung des Auskunftsverfahrens

So ein Verfahren kann mitunter lange dauern. Damit ein bestehender Auskunftsanspruch bei Löschung der Daten nicht ins Leere läuft und dann nicht durchsetzbar ist, soll es zudem eine neue Möglichkeit geben, gerichtlich die Sicherung der Beweise anzuordnen. Nach Einleitung des Auskunftsverfahrens sollen alle Diensteanbieter zur Sicherung von Daten verpflichtet werden können. Solche Daten sind Bestands- und Nutzungsdaten des Verletzers sowie die digitale Äußerung selbst. Die Speicherung soll bis zum Abschluss des Auskunftsverfahrens andauern und bereits in frühem Verfahrensstadium angeordnet werden können.
Gleichzeitig wird das gerichtliche Verfahren in geeigneten Fällen beschleunigt. Bei offensichtlichen Rechtsverletzungen wie etwa Formalbeleidigungen kann das Gericht die Diensteanbieter bereits durch eine einstweilige Anordnung verpflichten, Auskunft über die Daten eines Verfassers zu erteilen. Das zweistufige Verfahren kann in solchen Fällen binnen weniger Tage durchlaufen werden.
Dabei wurde eine „One-Stop-Shop-Lösung“ gewählt. Gemeint ist, dass die gerichtliche Zuständigkeit bei den Landgerichten gebündelt wird. Welches Landgericht dann zuständig ist, bestimmen die Länder selbst.
Anspruch auf eine richterlich angeordnete Accountsperre
Eine weitere wesentliche Maßnahme soll das Instrument der richterlichen Accountsperre gegen „notorische Rechtsverletzer“ werden. Folge eines durchgesetzten Anspruchs soll die zeitlich angemessene Sperrung des Accounts sein, über den die Straftat oder Persönlichkeitsverletzung verbreitet wurde. Der Anspruch richtet sich dabei nicht gegen den Verletzer, sondern gegen den Diensteanbieter. Dadurch sind auch Fälle gedeckt, in denen die Identität des Accountinhabers unbekannt ist. Betroffene sollen durch einen solchen Anspruch effektiv gegen wiederholte Verletzungen geschützt werden, die über den gleichen Account verbreitet werden.
Der Anspruch soll an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sein. Erste Voraussetzung ist, dass über den Account das allgemeine Persönlichkeitsrecht schwerwiegend beeinträchtigt wurde. Außerdem muss die Gefahr der Wiederholung durch den konkreten Account bestehen. Auch muss die Maßnahme im konkreten Fall verhältnismäßig sein. So wird eine jeweilige Abwägung der Grundrechte der Beteiligten vorgenommen werden, wobei eine Verletzung der Community-Standards nicht genügt. Es muss zudem geprüft werden, ob die Löschung der digitalen Inhalte als milderes Mittel in Betracht käme. Vor der richterlichen Anordnung müssen Accountinhaber außerdem vom jeweiligen Diensteanbieter auf eine Sperre hingewiesen werden und sollen Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen.
Zustellung soll erleichtert werden
Bisher existiert bereits eine Pflicht im NetzDG, dass soziale Netzwerke einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen haben. Das ist vor allem wichtig, damit Betroffene wissen, an wen sie sich bei Verletzung wegen einer Löschung wenden können. Aber auch Zeit- und Kostenersparnisse sind Vorteile der Regelung. Diese Pflicht soll durch das Gesetz gegen digitale Gewalt noch fortgeschrieben und ausgeweitet werden. Genauer sollen auch außergerichtliche Schreiben von der Zustellung umfasst sein. Das ist deshalb wichtig, weil Diensteanbieter dann Kenntnis vom Inhalt der Schreiben erlangen, was für die Durchführung späterer Verfahrensschritte wichtig sein kann.
Stellungnahmen zu dem Eckpunktepapier und aktueller Stand
Mittlerweile liegen zu dem Eckpunktepapier die Stellungnahmen von involvierten und interessierten Kreisen, wie beispielsweise der Bundesrechtsanwaltskammer, der Gesellschaft für Freiheitsrechte, HateAid oder Meta vor. Insbesondere Fachverbände äußerten sich positiv, während vor allem Netzaktivisten eine zu starke Einschränkung der Meinungsfreiheit befürchten. Nun arbeitet das BMJ einen entsprechenden Gesetzesentwurf aus, der die Stellungnahmen sinnvoll einbezieht. Dieser Entwurf wiederum kann noch mehrmals überarbeitet werden und wird nach einer umfassenden Prüfung als Gesetzesinitiative eingebracht. Das soll noch in diesem Jahr geschehen.
Momentan sieht es also danach aus, dass einer rechtzeitigen Umsetzung des DSA zuzüglich des Gesetzes gegen digitale Gewalt nichts im Wege steht. Was jedoch der praktischen Umsetzung des gesetzten Ziels, nämlich dem wirksamen Schutz gegen digitale Gewalt, entgegensteht, sind die jüngsten Sparmaßnahmen der Bundesregierung. So entfällt durch diese auch die Förderung der gemeinnützigen Organisation HateAid. Diese ist die größte Beratungsstelle für Betroffene von Hassrede. Es bleibt also abzuwarten, wie die Bundesregierung künftig umfassende Beratungsangebote bereitstellen will, wie sie es im Koalitionsvertrag angekündigt haben. Nur durch solche Angebote für Betroffene kann der Schutz von Opfern für Hass im Netz auch umfassend gewährleistet werden.
jsc/ahe