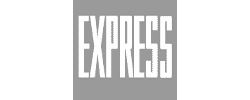Die GEMA klagt gegen OpenAI, den Anbieter des Chatbots ChatGPT. Das LG München I verhandelte nun und muss jetzt hochrelevante Urheberrechtsfragen klären. Das Urteil im November darf daher mit Spannung erwartet werden.

Im November 2024 reichte die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) eine Klage gegen OpenAI und deren Tochtergesellschaft OpenAI Ireland Ltd. vor dem Landgericht (LG) München I ein. Der Vorwurf der GEMA: OpenAI habe ohne erforderliche Lizenz geschützte Songtexte zum Training seines KI-Systems ChatGPT verwendet und diese auch in den Ausgaben des Chatbots wiedergegeben. Das Verfahren könnte wegweisend für den Umgang mit Urheberrechten im digitalen Zeitalter werden. Die Verhandlung fand am 29. September 2025 statt, das Urteil wird für den 11. November 2025 erwartet (LG München I, 29.09.2025, Az. 42 O 14139/24).
GEMA verklagt OpenAI
Die GEMA klagt gegen OpenAI, weil das Unternehmen nach Überzeugung der GEMA urheberrechtlich geschützte Songtexte aus dem Repertoire deutscher Künstler in seinem KI-Modell verwendet habe, ohne zuvor Lizenzen für diese Nutzung zu erwerben. Unstreitig wurde ChatGPT mit den Texten von bekannten deutschen Liedern trainiert. Darunter befinden sich Songs wie „Atemlos“ von Kristina Bach, „Über den Wolken“ von Reinhard Mey und „Bochum“ von Herbert Grönemeyer. In Tests konnte der Chatbot auf einfache Anfragen hin diese Songtexte in weiten Teilen wiedergeben, was die GEMA als unzulässige Vervielfältigung betrachtet.

Soforthilfe vom Anwalt
Sie brauchen rechtliche Beratung? Rufen Sie uns an für eine kostenlose Ersteinschätzung oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Das Training des KI-Modells durch OpenAI sei nach Ansicht der GEMA rechtswidrig durchgeführt worden, da keine Lizenzgebühren an die Urheber gezahlt wurden. Die GEMA argumentiert, dass die Wiedergabe der Songtexte durch ChatGPT eine Urheberrechtsverletzung darstelle. Dies betreffe insbesondere den Bereich der öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG, der eine Lizenzierung erforderlich mache, wenn urheberrechtlich geschützte Werke genutzt würden.
OpenAI wehrt sich gegen die Vorwürfe. Das Unternehmen betont, dass die KI keine spezifischen Daten speichere oder kopiere, sondern lediglich das „Wissen“ aus einer Vielzahl von Quellen in den Parametern des Modells verarbeite. Es sei nicht die Absicht, bestimmte Texte zu reproduzieren, sondern das Modell generiere Antworten auf Basis von Wahrscheinlichkeiten und Analysen. Ein weiterer zentraler Punkt in der Verteidigung ist die Frage der Verantwortlichkeit für die Inhalte, die der Chatbot ausgibt. OpenAI argumentiert, dass die Verantwortung bei den Nutzern liege, die die Prompts eingeben, und nicht beim Unternehmen selbst.

Verfahren von besonderer Bedeutung
Eine der zentralen Fragen, die das LG München I nun klären muss, wird sein, inwiefern die Urheberrechtsschranke des Text- und Data Mining nach § 44b UrhG greift oder nicht. Diese Schranke erlaubt das automatisierte Absuchen des Internets und das Sammeln von Daten, auch aus urheberrechtlich geschützten Werken, zu Analysezwecken. Ob darunter das Training von KI fällt, ist jedoch umstritten. In jedem Fall hat die GEMA jedoch nach eigenen Angaben stellvertretend für ihre Mitglieder erklärt, dass ihre Werke nur nach Erwerb einer Lizenz zum Training von KI-Systemen verwendet werden dürfen. Durch diesen Nutzungsvorbehalt soll sichergestellt werden, dass die Urheber an den Einnahmen, die durch KI-Systeme erzielt werden, angemessen beteiligt werden. Doch eben diese Lizenzen seien nicht erteilt worden.
Das Urteil wird insbesondere mit Spannung erwartet, da eine der offenen Fragen die originalgetreue Wiedergabe der Songtexte durch KI betrifft. Es muss geklärt werden, ob eine solche Wiedergabe der Texte eine urheberrechtlich relevante Nutzung darstellt, insbesondere im Hinblick auf die Vervielfältigung der geschützten Werke. Diese Frage ist bislang noch rechtlich ungeklärt, da die rechtliche Einordnung der Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten Inhalten durch KI-Modelle in der bisherigen Rechtsprechung nicht abschließend behandelt wurde.
Das Verfahren vor dem LG München I hat weitreichende Bedeutung, sowohl für die Musikindustrie als auch für den Umgang mit KI und Urheberrecht. Es ist eines der ersten Verfahren dieser Art und könnte zu einer grundlegenden Klärung führen, wie der Urheberrechtsschutz auf neue Technologien wie KI angewendet wird.
GEMA führt weiteres Verfahren gegen SunoAI
Ein weiteres Verfahren der GEMA betrifft das KI-Unternehmen Suno, das mit seinen Systemen ebenfalls urheberrechtlich geschützte Werke genutzt haben soll, ohne entsprechende Lizenzen zu erwerben. Ähnlich wie bei OpenAI wird hier die Frage gestellt, ob das Training mit diesen Daten ohne Vergütung der Urheber und ohne Lizenzierung rechtlich zulässig ist. Die GEMA hat bereits rechtliche Schritte eingeleitet, um auch hier eine Klärung der Urheberrechte zu erreichen. Dieses Verfahren könnte ebenfalls weitreichende Konsequenzen für die generative KI-Branche haben und stellt ein weiteres bedeutendes Puzzleteil im aktuellen rechtlichen Rahmen der KI-Nutzung dar.
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung hat das LG mit den Parteien die Sach- und Rechtslage intensiv diskutiert. Termin zur Verkündung einer Entscheidung bestimmte das LG auf den 11.11.2025. Über den weiteren Verlauf des Verfahrens werden wir berichten.
tsp