Kündigungsschutz
Arbeitnehmer können nicht einfach so auf die Straße gesetzt werden. Hat ein neuer Beschäftigter die Probezeit überstanden und ist seit mindestens sechs Monaten im Betrieb beschäftigt, unterliegt er den Vorgaben des Kündigungsschutzes, der klare Regeln dafür aufstellt, wann, unter welchen Bedingungen oder mit welchen Folgen ein Mitarbeiter überhaupt gekündigt werden darf. Alles zum Kündigungsschutz hier im Überblick.
Auf einen Blick
- Der allgemeine Kündigungsschutz gilt für alle Arbeitnehmer, die länger als sechs Monate in einem Unternehmen beschäftigt sind.
- Darüber hinaus gibt es noch den besonderen Kündigungsschutz. Dieser gilt für besonders schutzwürdige Arbeitnehmer, wie zum Beispiel Schwangere, Betriebsratsmitglieder oder Schwerbehinderte.
- Der Kündigungsschutz ist vor allem im Kündigungsschutzgesetz geregelt.
- Es sieht nur drei Kündigungsgründe vor: die personenbedingte Kündigung, die verhaltensbedingte Kündigung und die betriebsbedingte Kündigung.
- Jede Kündigungsart ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft.
- Gekündigte können sich im Rahmen einer Kündigungsschutzklage gegen eine erhaltene Kündigung wehren, falls sie deren Zulässigkeit anzweifeln.
Soforthilfe vom Anwalt
Unsicher, ob Ihre Kündigung rechtens ist? Nutzen Sie unseren kostenfreien Arbeitsrecht-Checker. Sie erhalten umgehend am Ende der Abfrage eine Einschätzung dazu, ob akuter Handlungsbedarf besteht und wie Sie nun weiter vorgehen sollten.
Ab wann gilt der Kündigungsschutz?
Arbeitnehmer sind ihrem Arbeitgeber strukturell unterlegen – so die Perspektive des Gesetzgebers. Arbeitgeber verfügen über größere finanzielle Spielräume und haben so den längeren Atem. In Verhandlungen oder Auseinandersetzungen ist der Arbeitnehmer grundsätzlich in der unterlegenden Position. Um dieses strukturelle Ungleichgewicht auszugleichen, gibt es in Deutschland diverse rechtliche Vorgaben, die die Kündigung eines Arbeitnehmers unmöglich machen oder zumindest erschweren.
Grundsätzlich wird dabei unterschieden zwischen dem allgemeinen Kündigungsschutz und dem besonderen Kündigungsschutz. Der allgemeine Kündigungsschutz gilt bereits für jeden Arbeitnehmer, der mindestens sechs Monate in einem Unternehmen beschäftigt ist.
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist.
§1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
Besonderer Kündigungsschutz
Außerdem behält der Gesetzgeber gegenüber besonders schutzwürdigen Arbeitnehmern weitere Einschränkungen vor, die auch als Regelungen des besonderen Kündigungsschutzes bezeichnet werden. Diese schutzwürdigen Gruppen sind:
Schwerbehinderte Arbeitnehmer
Arbeitgeber sind verpflichtet, Kündigungen von Schwerbehinderten möglichst zu vermeiden. Sollte es doch zu einer Kündigung kommen, gelten hohe Auflagen. So müssen beispielsweise Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung benachrichtigt werden. Das Integrationsamt muss zudem der Kündigung zustimmen.
Schwangere Arbeitnehmerinnen
Ab dem Beginn der Schwangerschaft bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung gilt eine Arbeitnehmerin als äußerst schutzbedürftig. Eine Kündigung dieser Gruppe von Arbeitnehmerinnen ist nur außerordentlich und unter Zustimmung der für den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörde möglich.
Betriebsrat
Mitglieder des Betriebsrates unterliegen ebenfalls einem besonderen Kündigungsschutz, da sie keine negativen Konsequenzen aufgrund ihres Einsatzes im Betriebsrat fürchten sollen. Kündigungen können daher nur außerordentlich und unter Zustimmung der Mehrheit des Betriebsrates erfolgen.
Beschäftigte in Elternzeit
Beschäftigte in Elternzeit – egal ob Vater oder Mutter – unterliegen ab dem Zeitpunkt der Beantragung (frühestens aber acht Wochen vor dem Beginn) ebenso wie Schwangere dem besonderen Kündigungsschutz. Auch hier gilt: nur außerordentliche Kündigungen unter Zustimmung der obersten Landesbehörde möglich.
Auszubildende
Nach der Probezeit (mindestens einen Monat, höchstens vier Monate) fallen Azubis ebenfalls unter den besonderen Kündigungsschutz. Dieser findet sich jedoch nicht im Kündigungsschutzgesetz, sondern in §22 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz (kurz: BBiG).
Angestellte in Pflegezeit
Wer sich zuhause um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmern muss, kann im Rahmen des Pflegezeitengesetzes (kurz: PflegeZG) gegenüber dem Arbeitgeber eine Pflegezeit ankündigen. Sechs Monate vorher und während der Pflegezeit ist eine Kündigung nur außerordentlich möglich. Auch hier ist die Zustimmung der obersten Landesbehörde erforderlich.
Datenschutzbeauftragter
Auch der Datenschutzbeauftragte eines Unternehmens unterliegt hinsichtlich einer Kündigung besonderen Bestimmungen. Er darf ordentlich nicht im Zeitraum seiner Berufung bis einschließlich ein Jahr nach seiner Abberufung aus dieser Funktion gekündigt werden.
💡 Wichtig:
Der besondere Kündigungsschutz ergibt sich nicht nur aus dem Kündigungsschutzgesetz. Auch speziellere Regelungen wie das Berufsbildungsgesetz oder das Pflegezeitengesetz können Bestimmungen zum Kündigungsschutz enthalten!
Kündigungsschutz im Alter
Der Irrglaube, ein Arbeitnehmer werde mit steigendem Alter zunehmend unkündbar, ist immer noch weit verbreitet. Doch warum ist das so? Fakt ist: ältere Arbeitnehmer genießen keinen besonderen Kündigungsschutz.
Aber: kommt es zu betriebsbedingten Kündigungen, schreibt der Gesetzgeber bei der Auswahl der zu kündigenden Mitarbeiter die Form der Sozialauswahl vor. Ein Kriterium der Sozialauswahl ist dabei das Lebensalter. Zusätzlich werden außerdem die Jahre der Betriebszugehörigkeit betrachtet – zwei Kennzahlen die häufig in engem Zusammenhang stehen. In der Praxis heißt das oft: jüngere, unerfahrenere Kollegen werden häufiger der betriebsbedingten Kündigung zum Opfer fallen, als ältere. Aus diesem Mechanismus hat sich wohl die Mär des unkündbaren Unternehmensveteranen gebildet.
In der Praxis kommen bei älteren Arbeitnehmern jedoch immer häufiger Auflösungs- oder Abfindungsvereinbarungen ins Spiel. Eine Kündigung wäre für den Arbeitgeber oft risikobehaftet, da Kündigungsschutzklagen keine Seltenheit sind. Da einigt man sich lieber mit dem Arbeitnehmer über die einvernehmliche Auflösung des Arbeitsvertrages gegen eine Abfindungszahlung.
Kündigungsschutz in Kleinbetrieben
Kleinbetrieben kommt im Gegensatz zu Mittelständlern oder Konzernen eine besondere Rolle zu: für sie gelten die Regelungen des Kündigungsschutzes nicht in vollem Umfang. Gemäß §23 Abs. 1 S. 2 und 3 des Kündigungsschutzgesetzes gelten bestimmte Regelungen in den Fällen nicht, in denen ein Unternehmen weniger als fünf, beziehungsweise weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigt.
Ermittlung der Betriebsgröße:
- 1 Vollzeitkraft = 1 Mitarbeiter
- 1 Teilzeitkraft (bis zu 20h/Woche) = 0,5 Mitarbeiter
- 1 Teilzeitkraft (20-30h/Woche) = 0,75 Mitarbeiter
- Auszubildende, Praktikanten, geschäftsführender Gesellschafter à Ohne Zählung
- Mutterschutz/Elternzeit/Pflegezeit à werden regulär mitgezählt (gibt es einen Vertreter für genau diesen Arbeitnehmer, zählt der Arbeitsplatz jedoch nur einmal)
Aus der so ermittelten Berechnung der Betriebsgröße ergeben sich dann die jeweils geltenden Regelungen. So gilt:
Ein Unternehmen gilt als Kleinbetrieb, sobald es regelmüßig 10 oder weniger Mitarbeiter beschäftigt.
Ausnahme: soll ein Arbeitsverhältnis gekündigt werden, das 2003 oder früher geschlossen wurde, gilt ein Unternehmen als Kleinbetrieb, sobald weniger als 6 sogenannte „Alt-Arbeitnehmer“ (vor 2004) beschäftigt sind.
Ist ein Unternehmen Kleinbetrieb, so finden die Bestimmungen des allgemeinen Kündigungsschutzes keine Anwendung. Der besondere Kündigungsschutz, zum Beispiel für Schwangere, gilt jedoch auch in Kleinbetrieben. Ordentliche Kündigungen jedoch unterliegen keinen besonderen Auflagen; Arbeitgeber können also in dem Fall auch eine Kündigung ohne Grund aussprechen.
Aber: das heißt nicht, dass sie komplett schutzlos sind und der Arbeitgeber willkürlich Kündigungen aussprechen darf. Auch in Kleinbetrieben dürfen Kündigungen nicht missbräuchlich oder treuwidrig ausgesprochen werden. Sie müssen also den Allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsätzen entsprechen oder ein Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme aufweisen. Auch sittenwidrige Kündigungen (zum Beispiel aus Rache) sind ausgeschlossen.
Auch die gesetzlichen Kündigungsfristen finden weiterhin regulär Anwendung. Falls nichts Abweichendes im Arbeitsvertrag vereinbart, gilt also:
- Innerhalb der Probezeit: Kündigungsfrist von zwei Wochen
- Innerhalb der ersten zwei Jahre: Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. oder Monatsletzten
- Zwischen zwei und fünf Jahren Betriebszugehörigkeit: Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Monatsende
- Zwischen fünf und acht Jahren Betriebszugehörigkeit: Kündigungsfrist von 2 Monaten zum Monatsende
Auch Beschäftigte eines Kleinbetriebes, die eine Kündigung erhalten, können sich gegen ihre Kündigung wehren. Eine Kündigungsschutzklage kann innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Kündigung beim zuständigen Amtsgericht eingelegt werden. Hier muss der Gekündigte dann darlegen, warum er die erhaltene Kündigung für unwirksam hält.
Wie WBS Ihnen helfen kann
Das Arbeitsrecht und speziell der Kündigungsschutz sind komplexe Rechtsgebiete, in denen es oft auf Details ankommt. Ob Sie nun unter besonderem Kündigungsschutz stehen, sich gegen eine Kündigung wehren möchten oder generelle Fragen zum Arbeitsverhältnis haben – das Team von WBS steht Ihnen zur Seite. Mit unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihre Situation rasch einschätzen und Ihnen konkret weiterhelfen. Nutzen Sie einfach unseren kostenfreien Arbeitsrecht-Checker. Sie erhalten umgehend am Ende der Abfrage eine Einschätzung dazu, ob akuter Handlungsbedarf besteht und wie Sie nun weiter vorgehen sollten.

Zeitersparnis
Mithilfe unseres Checkers erhalten Sie schnell und einfach die Hilfe, die Sie suchen. Ob in der Position als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber.
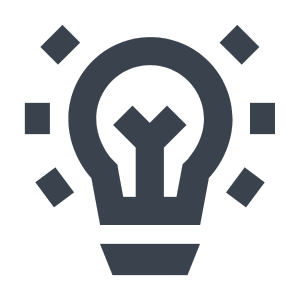
Spezialisierte Expertise
Sie suchen Rat im Arbeitsrecht? Wir prüfen Ihren Fall und beraten Sie kompetent, dank unserer jahrelangen Erfahrung.

Individuelle Beratung
Wurde bei Ihrer Kündigung der Kündigungsschutz missachtet? Wir besprechen Ihre individuellen Möglichkeiten und sorgen dafür, dass alles ordnungsgemäß abgewickelt wird.
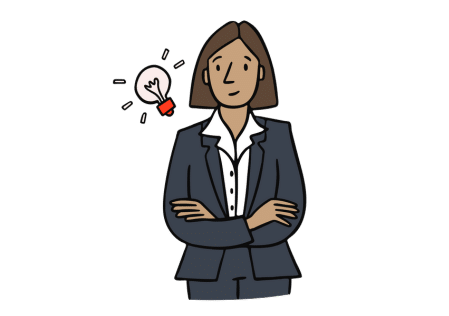
Zusammen vor Gericht: 300.000 Kündigungsklagen jährlich in DE
- Rund 27% der Kündigungen in DE münden in einer Kündigungsschutzklage und damit vor Gericht. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
- Das entspricht rund 300.000 eingereichte Klagen pro Jahr, so der Deutsche Arbeitsgerichtsverband
- 75% der Klagen enden mit einem Vergleich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
- Sichern Sie sich Ihren Vorteil und holen Sie rechtlichen Beistand für Ihre Kündigungsschutzklage.