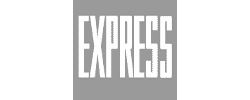Der Streit zwischen dem Axel-Springer-Konzern und der Kölner Eyeo GmbH, die den Werbeblocker AdblockPlus vertreibt, geht in die nächste Runde, denn nach dem BGH, ist nun wieder das OLG Hamburg gefragt.

Schon seit Jahren befinden sich der Axel-Springer-Konzern und die Kölner Eyeo GmbH, die den Werbeblocker AdBlock Plus vertreibt, im Streit. Der Medienkonzern beklagt, der HTML-Code der Webseite werde durch den Einsatz des Werbeblockers unzulässig verändert, was gegen das Urheberrecht verstoße.
Nachdem der Verlag mit seiner Klage in den Vorinstanzen gescheitert war, hat der Bundesgerichtshof (BGH) nun entschieden, dass zentrale Rechtsfragen noch nicht geklärt seien. Das Verfahren wurde deshalb an das OLG Hamburg zurückverwiesen (BGH, Urteil vom 31. Juli 2025, Az. I ZR 131/23).
Im Rechtsstreit klagt der Axel-Springer-Konzern gegen die Kölner Eyeo GmbH, die den inzwischen weltweit führenden Werbeblocker Adblock Plus vertreibt. Zentrale Frage ist, ob der Einsatz des Werbeblockers eine unzulässige Umgestaltung der Programmierung der Webseiten darstellt und somit das Urheberrecht des Verlags verletzt.
Verletzt AdBlockPlus Urheberrechte?
Aus Sicht von Axel Springer ist dies der Fall. Daher macht der Konzern geltend, dass es sich bei der Programmierung ihrer Webseiten um Computerprogramme im Sinne des § 69a Abs. 1 UrhG handele, an denen Axel Springer die ausschließlichen Nutzungsrechte zustünden.
Bei Aufruf der Webseiten durch den Webbrowser werde die HTML-Datei in den Arbeitsspeicher auf dem Endgerät des Nutzers übertragen. Zur Anzeige der HTML-Datei interpretiert der Webbrowser ihren Inhalt, wobei er zusätzliche Datenstrukturen anlegt. Axel Springer sieht in der Beeinflussung dieser Datenstrukturen durch den Werbeblocker eine unberechtigte Umarbeitung eines Computerprogramms im Sinne des § 69c Nr. 2 UrhG und nimmt die Eyeo GmbH daher auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch.

Soforthilfe vom Anwalt
Sie brauchen rechtliche Beratung? Rufen Sie uns an für eine kostenlose Ersteinschätzung oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Programmabläufe würden blockiert oder überschrieben, was ein Eingriff in die Substanz sei, denn es würden nicht nur Inhalte unterdrückt. So werde die gesamte Finanzierung einer Webseite kaputt gemacht.
Die Eyeo GmbH hingegen betont das Recht der Internetnutzer, ihre Browser so einzustellen, wie sie es möchten. Durch Werbeblocker würden Programme nicht umgearbeitet. Somit gebe es keine urheberrechtliche Relevanz. Es dürfe hier nicht zu einer Ausweitung des Urheberrechtsschutzes auf Funktionalitäten kommen, der für PC-Programme nicht vorgesehen sei. Sonst könnten künftig z.B. Probleme etwa bei der Installation von Jugendschutzsoftware bestehen.
Axel Springer bislang erfolglos
Das Landgericht Hamburg hatte die Klage abgewiesen (LG Hamburg, Urteil vom 14. Januar 2022, Az. 308 O 130/19). Die Berufung Axel Springers vor dem Oberlandesgericht (OLG) Hamburg blieb ebenfalls erfolglos (OLG Hamburg, Az. Urteil vom 24. August 2023, Az. 5 U 20/22).
Das OLG hatte ausgeführt, es könne offenbleiben, ob die Dateien, die beim Webseitenaufruf an den Nutzer übermittelt würden, als Computerprogramm nach § 69a UrhG geschützt seien und Axel Springer über ausschließliche Nutzungsrechte verfüge. Die vom Werbeblocker erzeugten Vorgänge nach der Speicherung der Daten im Arbeitsspeicher stellten keine Umarbeitung im Sinne von § 69c Nr. 2 UrhG dar.
Die Beeinflussung des Programmablaufs durch externe Befehle sei ohne Veränderung der Programmsubstanz oder Herstellung einer abgeänderten Vervielfältigung keine Umarbeitung des Programms. Der Werbeblocker wirke lediglich auf die vom Browser erzeugten Datenstrukturen ein, die im Rahmen der Darstellung des HTML-Dokuments als temporäres Zwischenergebnis bei Ausführung der Webseitenprogrammierung berechnet würden. Dies sei nur ein Eingriff in den Programmablauf und nicht in die Programmsubstanz.
EuGH-Urteil zu Cheat-Software abgewartet
Der BGH wollte zunächst die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in einem ähnlichen Fall abwarten. Dort ging es um die urheberrechtliche Zulässigkeit von Cheat-Software, die Nutzern erlaubt, Programme auf Spielkonsolen zu manipulieren. Im Oktober entschied der EuGH, dass solche Software das Urheberrecht nicht grundsätzlich verletze, solange sie nur temporär Daten im Arbeitsspeicher einer Konsole verändere. Zu diesem Urteil durften auch die Parteien im BGH-Verfahren Stellung nehmen.
Der BGH wollte zunächst die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in einem ähnlichen Fall abwarten. Dort ging es um die urheberrechtliche Zulässigkeit von Cheat-Software, die Nutzern erlaubt, Programme auf Spielkonsolen zu manipulieren. Im Oktober entschied der EuGH, dass solche Software das Urheberrecht nicht grundsätzlich verletze, solange sie nur temporär Daten im Arbeitsspeicher einer Konsole verändere. Inzwischen hat auch der BGH das Urteil bestätigt und klargestellt, dass „Cheat-Software“ für Spielkonsolen nicht gegen Urheberrecht verstoße, soweit sie Objekt- oder Quellcode der Spielesoftware nicht umschreibe.
BGH sieht weiteren Klärungsbedarf
Der BGH hat daher nun im Fall des Adblockers AdBlock Plus entschieden und die Entscheidung des OLG Hamburg aufgehoben, soweit Axel Springer Ansprüche auf die Verletzung urheberrechtlich geschützter Computerprogramme stützt. Der BGH sieht noch erheblichen rechtlichen Klärungsbedarf und hat die Sache daher zur weiteren Aufklärung an das OLG Hamburg zurückverwiesen (BGH, Urteil vom 31. Juli 2025, Az. I ZR 131/23).
Nach Auffassung des BGH habe das OLG nicht einfach davon ausgehen dürfen, dass durch die Nutzung des Werbeblockers keine Umarbeitung oder Vervielfältigung eines Computerprogramms im Sinne von § 69c Nr. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG) vorliege. Zwar greife der Werbeblocker nur auf die vom Browser erzeugten Datenstrukturen, also DOM-Knotenbaum und CSS-Strukturen, zu, nicht aber direkt auf den HTML-Quellcode. Dennoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch diese Datenstrukturen als Ausdrucksformen eines geschützten Computerprogramms einzustufen seien.
Der BGH kritisiert insbesondere, dass das OLG weder hinreichend festgestellt habe, was genau der Schutzgegenstand sei, auf den sich Axel Springer berufe, noch ob dieser tatsächlich schutzfähig sei. Das OLG habe offengelassen, ob etwa der vom Browser erzeugte Bytecode oder der auf Basis dieses Codes erzeugte Programmablauf eine Ausdrucksform darstelle, die urheberrechtlich geschützt werden könne. Genau dies sei jedoch entscheidend für die Frage, ob eine unzulässige Umarbeitung oder eine abändernde Vervielfältigung im Sinne der urheberrechtlichen Vorschriften vorliege.
Auch die technische Argumentation Axel Springers zur Funktionsweise von Browsern sei vom OLG nicht ausreichend gewürdigt worden. Insbesondere der Hinweis, dass moderne Browser nicht direkt maschinenlesbaren Objektcode ausführen, sondern über Engines arbeiten, die aus HTML, CSS und JavaScript zunächst einen Bytecode erzeugen, sei von Bedeutung. Wenn dieser Bytecode oder der daraus entstehende Code als Computerprogramm im Sinne des Urheberrechts anzusehen sei, dann könne womöglich ein Eingriff durch AdBlock Plus eine Rechtsverletzung darstellen.
Die Karlsruher Richter betonen, dass sich aus dem OLG-Urteil nicht eindeutig ergebe, ob und welche Bestandteile der Webseitenprogrammierung als schutzfähiges Computerprogramm anzusehen seien. Gerade im Hinblick auf moderne, modulare Webseitenarchitektur, bestehend aus eigenem und fremdem Code, sei eine sorgfältige Abgrenzung erforderlich. Auch sei unklar, ob Axel Springer überhaupt über ausschließliche Nutzungsrechte an allen relevanten Bestandteilen verfüge.
In der Konsequenz könne daher derzeit nicht abschließend beurteilt werden, ob der Werbeblocker eine unzulässige Umarbeitung oder Vervielfältigung eines geschützten Programms bewirke. Das OLG Hamburg muss diese Fragen nun eingehend prüfen und neue Feststellungen treffen. Die übrige Revision hat der BGH im Übrigen als unzulässig verworfen.
Damit ist zwar noch keine abschließende Entscheidung in der Sache gefallen, jedoch hat der BGH der Klägerseite einen Teilerfolg verschafft. Der Rechtsstreit geht in eine neue Runde.
Werbeblocker AdblockPlus schon häufiger auf dem Prüfstand
Das Kölner Unternehmen Eyeo vertreibt seit 2011 die Software Adblock Plus. Die Software gibt Nutzern die Möglichkeit, durch Installieren einer Browser-Erweiterung angezeigte Werbung auf besuchten Websites zu blockieren. Dabei kommt ein Filter zum Einsatz, welcher Serverpfade und Dateimerkmale der jeweiligen Website identifiziert und die Werbeeinblendung verhindert. Dabei greift der Filter auf eine sogenannte Blacklist zurück. Das ist eine Datenbank, welche die verschiedenen Serverpfade und Codes, die Werbung einblenden, beinhaltet. Eyeo bietet jedoch Websitebetreibern an, durch Abschluss sog. Whitelisting-Verträge gegen ein Entgelt bestimmte Werbung, die für den Nutzer weniger aufdringlich sein soll, zuzulassen.
Das Geschäftsmodell der Werbeblocker steht seit Jahren immer wieder auf dem Prüfstand, so auch im April 2018, als sich die Parteien bereits schon einmal vor dem BGH trafen.
In dem damaligen Verfahren stritten der Axel Springer Verlag und die Eyeo GmbH darum, ob das Angebot des Werbeblockers AdBlock Plus gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstoße. Zuvor hatten die meisten Gerichte die Software für legal erklärt. Und auch der BGH wies die Springer-Klage gegen AdBlock Plus seinerzeit vollständig ab. Werbeblocker seien rechtlich zulässig, so die Richter. In der Folge schritt auch das BVerfG nicht zur Hilfe. Die Verfassungsbeschwerde des Axel Springer Verlags wurde nicht zur Entscheidung angenommen.
Wie der erneute Versuch des Axel Springer Verlags ausgehen wird, darf mit Spannung erwartet werden.