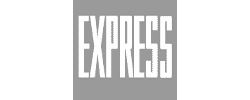Wer bereits seinen Führerschein wegen Alkohols am Steuer verloren hat und dann betrunken auf einem Mofa erwischt wird, dem droht auch die Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge wie Mofa, Fahrrad und E-Scooter. Dies hat das OVG des Saarlandes nun entschieden.

Ein aktuelles Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) des Saarlandes sorgt für Aufsehen. Die Richter bestätigten erstmalig, dass eine Behörde im Einzelfall auch das Fahren erlaubnisfreier Fahrzeuge untersagen darf, wenn ein Fahrer eine angeordnete medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) verweigert. Damit weicht das Gericht von anderslautenden Entscheidungen anderer Obergerichte ab (Oberverwaltungsgericht des Saarlandes, 23. Mai 2025, Az. 1 A 176/23).
Alkoholfahrt auf dem Mofa mit Folgen
Hintergrund des Verfahrens ist der Fall eines mehrfach alkoholauffälligen Fahrzeugführers. Der Mann war in der Vergangenheit mehrfach mit viel Alkohol gefahren. Seine frühere Fahrerlaubnis war schon Jahre zuvor entzogen worden. Er wich deshalb auf ein erlaubnisfreies Mofa aus. Im Juli 2019 lenkte er dieses Mofa mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,83 Promille durch den Abendverkehr. Er verlor die Kontrolle und stürzte gemeinsam mit seiner Begleiterin. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe. Schon zuvor hatte der Mann ähnlich hohe Werte am Steuer eines Pkw erreicht.
Im August 2020 erhielt der Mann ein Schreiben der Fahrerlaubnisbehörde. Darin forderte ihn die Behörde auf, innerhalb von vier Wochen ein medizinisch‑psychologisches Gutachten (MPU) einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle vorzulegen. Das Gutachten sollte klären, ob er Alkohol und Straßenverkehr künftig zuverlässig voneinander trennen kann. Der Mann reagierte nicht. Er meldete sich bei keiner Begutachtungsstelle und reichte kein Gutachten ein.
Als die Frist verstrichen war, untersagte die Behörde dem Mann per Bescheid das Führen sämtlicher erlaubnisfreier Fahrzeuge, ausdrücklich auch von Fahrrädern und E‑Scootern, und ordnete die sofortige Vollziehung an. Sie stützte sich dabei auf § 3 Absatz 1 Satz 1 FeV in Verbindung mit § 11 Absatz 8 FeV.
Dagegen hatte der Mann unter Verweis auf die Rechtsprechung anderer Obergerichte (u.a. VGH Bayern, Urteil vom 17. April 2023, Az. 11 BV 22.1234, sowie OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20. März 2024, Az.10 A 10971/23) unter anderem geltend gemacht, die Rechtsgrundlage, auf die sich die Untersagung stütze (§ 3 FeV), sei unwirksam. Sie sei zu unbestimmt bzw. unverhältnismäßig. Es sei – anders als für Kraftfahrzeuge – nicht klar geregelt, wann einer Person die Eignung fehle, mit einem Fahrrad am Straßenverkehr teilzunehmen. Insbesondere sei es unzulässig, das Führen eines Fahrrads ähnlich strengen Vorgaben zu unterwerfen wie das Führen eines Kraftfahrzeugs.
Gericht bestätigt Verbot für Fahrrad und Mofa
Das OVG entschied nun jedoch gegen den Mann. Das OVG stellte zunächst fest, dass § 3 FeV auf einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage beruhr. Er verwies auf § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und y des Straßenverkehrsgesetzes in der bis Juli 2021 geltenden Fassung. Dort habe der Gesetzgeber dem Verordnungsgeber eindeutig die Befugnis eingeräumt, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr gegenüber ungeeigneten Personen zu regeln. Nach Ansicht des OVG genüge diese Ermächtigung den Anforderungen aus Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes. Die Vorschrift benenne Zweck und Inhalt klar genug. Sie ermögliche gerade auch Verbote gegenüber Führern erlaubnisfreier Fahrzeuge.
Zwar greife ein generelles Fahrverbot für Fahrrad und Mofa stark in die Bewegungsfreiheit ein, jedoch weise schon eine einmalige Teilnahme am Straßenverkehr mit 1,6 Promille oder mehr auf eine erhebliche Kontrolleinbuße hin. Wer eine Blutalkoholkonzentration von 1,83 Promille erreiche, zeige nach medizinischer Erfahrung deutlich normabweichende Trinkgewohnheiten. Daraus folge eine gesteigerte Gefahr weiterer Delikte. Das gelte aus Sicht des OVG unabhängig von der Motorisierung des benutzten Fahrzeugs. Auch ein Radfahrer oder Mofafahrer könne andere Verkehrsteilnehmer zu riskanten Ausweichmanövern zwingen. Die geringere Masse der Fahrzeuge mindere die Gefahr nicht entscheidend.
Die Behörde müsse zwar bei erlaubnisfreien Fahrzeugen stets prüfen, ob mildere Mittel ausreichend sein könnten. Bei einer solchen Konstellation hielt das OVG jedoch die Anordnung einer MPU für zwingend erforderlich. Die Weigerung des Mannes, ein Gutachten beizubringen, rechtfertige den Schluss auf seine Ungeeignetheit. § 11 Absatz 8 FeV erlaube diesen Schluss ausdrücklich. Die Fahrerlaubnisbehörde nehme hier staatliche Schutzpflichten wahr und müsse entsprechend andere Verkehrsteilnehmer vor Personen schützen, die Alkohol und Straße nicht trennen könnten.
Bei einer Blutalkoholkonzentration von deutlich über 1,6 Promille seien die Risiken so gravierend, dass ein Verbot selbst dann verhältnismäßig sei, wenn nur Fahrräder betroffen seien. Die Richter ließen die Revision zu, weil eine höchstrichterliche Klärung bisher fehlt. Insbesondere müsse das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entscheiden, ob § 3 FeV bundesweit einheitlich anzuwenden sei.
Der Mann kann nun innerhalb eines Monats nach Zustellung Revision einlegen. Ob er diesen Schritt geht, bleibt abzuwarten. Sollte das BVerwG die Auffassung des OVGs bestätigen, könnten MPU Anordnungen nach Fahrrad- oder Mofa-Fahrten mit hohen Promillewerten künftig häufiger werden.
Die Entscheidung zeigt einmal mehr, dass „Alkohol am Lenker“ auch ohne Führerschein empfindliche Konsequenzen haben kann. Wer eine MPU verweigert, riskiert ein umfassendes Fahrverbot.
Nur wenige Monate zuvor hatte das OVG NRW in einem vergleichbaren Fall allerdings entgegengesetzt entschieden. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass § 3 FeV keine hinreichend bestimmte Rechtsgrundlage für ein Fahrverbot gegenüber Rad‑ und E‑Scooter‑Fahrern biete. Das sahen auch bereits das OVG Münster, das OVG Rheinland-Pfalz und der VGH Bayern so. Im Kern urteilten diese Gerichte allesamt, dass § 3 FeV nicht hinreichend bestimmt sei und daher als Rechtsgrundlage für ein Verbot, erlaubnisfreie Fahrzeuge zu fahren, nicht herangezogen werden könne. Die aktuelle Saarländische Entscheidung setzt sich damit bewusst von dieser Linie ab und verschärft so die bundesweite Kontroverse.
WBS.LEGAL – Ihr verlässlicher Partner im Verkehrsrecht und Verkehrsstrafrecht
WBS.LEGAL berät in sämtlichen Fragen des Verkehrsrechts und des Verkehrsstrafrechts. Unsere erfahrenen Anwälte prüfen Bescheide der Fahrerlaubnisbehörden, begleiten Sie im MPU‑Verfahren und setzen Ihre Rechte engagiert vor Gericht durch. Nehmen Sie gern unverbindlich Kontakt zu uns unter 0221 / 951 563 0 (Beratung bundesweit) auf.
Unser Tipp 🔥
Online-Checker: Sind Sie betroffen?

50 € für Facebook / Insta Nutzer
Meta verfolgt Sie durchs Netz. Verkaufen Sie jetzt Ihre Ansprüche – und erhalten 50 € direkt auf Ihr Konto. Keine Rechtsschutzversicherung nötig!

40 € für Android-Nutzer
Als Android-Nutzer schickt Ihr Smartphone jeden Tag Daten an Google. Mit unserem Partner Privacy Reclaim können Sie sofort Schadensersatzansprüche geltend machen.

Account gesperrt?
Wir helfen bei der Entsperrung Ihres Accounts auf Facebook, Instagram, Paypal, Amazon und vielen weiteren Portalen.
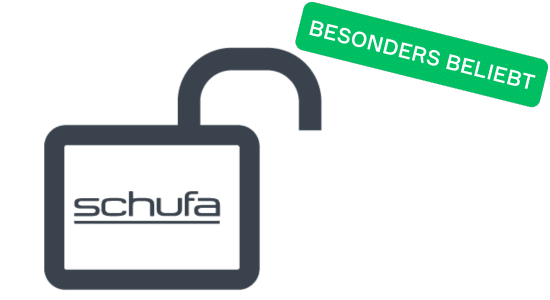
Ärger mit der Schufa?
Wir helfen, wenn bei Ihnen ein negativer Schufa-Eintrag vorliegt und Sie diesen löschen lassen möchten.